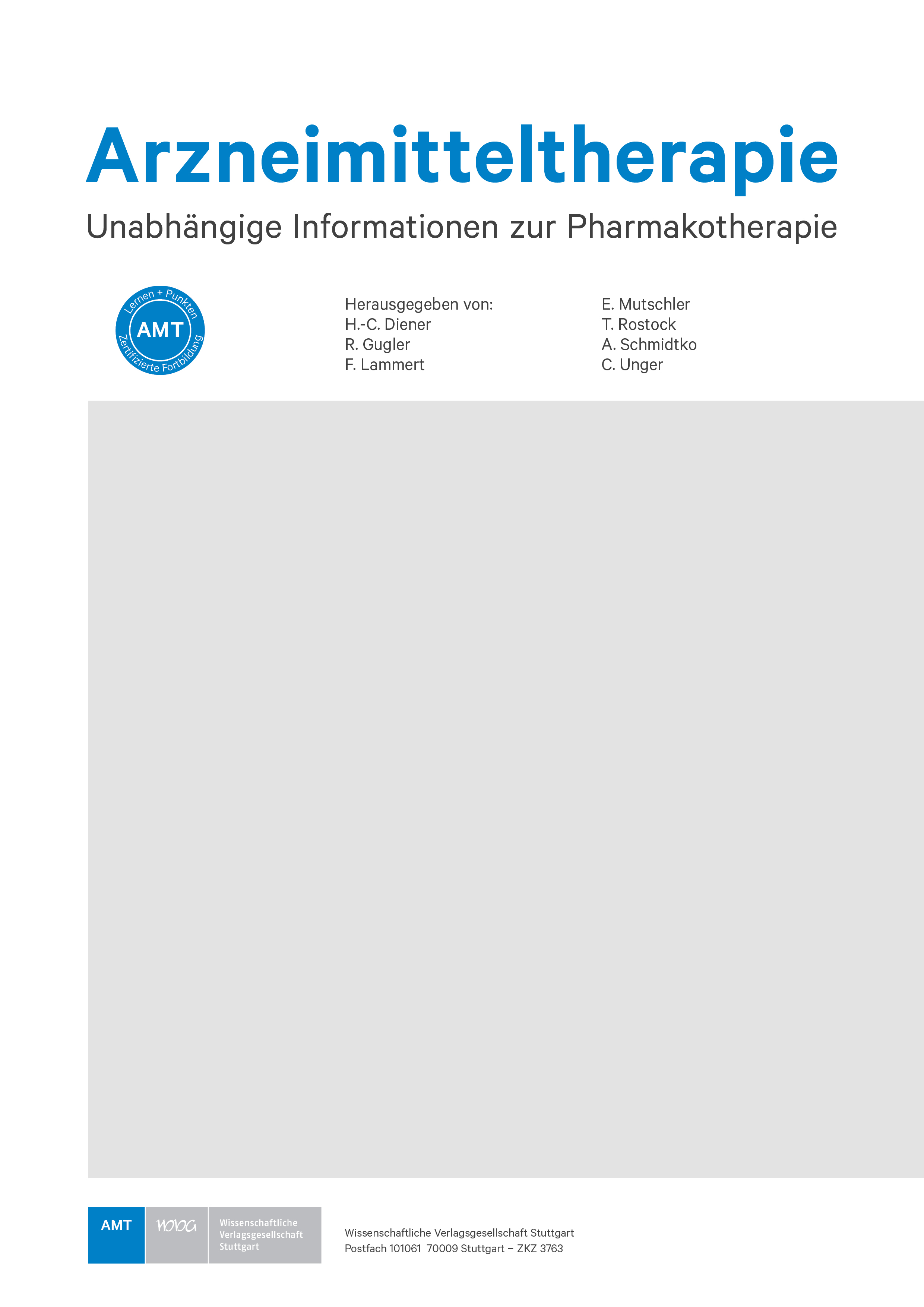Reaktionswege der Komplementkaskade und Möglichkeiten der therapeutischen Blockade
Aktueller Überblick zu verfügbaren Inhibitoren und ihren möglichen Einsatzgebieten
Das Komplementsystem stellt für den Menschen eine effektive Strategie dar, Fremdkörper (z. B. bekapselte Bakterien) schnell zerstören zu können, während körpereigene Zellen des Endothels oder Erythrozyten vor den zytolytischen Effekten geschützt sind. Allerdings kann es im Rahmen von Mutationen, wie bei der paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie, zu einem Verlust dieser Schutzmechanismen und einer hämolytischen Anämie kommen. Über viele Jahre wurde mit den Antikörpern Eculizumab und Ravulizumab, die gegen den Komplementfaktor C5 gerichtet sind, die Destruktion der Erythrozyten effektiv aufgehalten. Allerdings konnten damit extravasale Hämolysen, die über eine C3-assoziierte Opsonisierung von Erythrozyten erklärt werden können, nicht eingedämmt werden. Inhibitoren, die im proximalen Segment der Komplementkaskade angreifen, wie C3- und Faktor-B-Inhibitoren, spielen daher inzwischen eine zunehmend größere Rolle. Sie sind mit deutlich weniger Hämolysen verbunden. Einige der Wirkstoffe lassen sich zu Hause subkutan (z. B. Pegcetacoplan) oder oral (z. B. Iptacopan) verabreichen, sodass die Anwendung für die betroffenen Patienten einfacher geworden ist. Da die pharmakotherapeutische Eindämmung des Komplementsystems auch bei anderen seltenen Erkrankungen in der Neurologie (z. B. Myasthenia gravis) oder Nephrologie (z.B. C3-Glomerulopathien) eine Rolle spielt, wird der Einsatz einer vereinfachten Therapie mit Komplementinhibitoren in naher Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen.
Arzneimitteltherapie 2025;43:54–65.
 English abstract
English abstract
Pathways of the complement system and options for therapeutic inhibition – Current overview to available inhibitors and potential indications
The complement system represents an effective strategy for human beings to destroy foreign particles (incl. encapsulated bacteria) quickly whereas physiological endothelial or red blood cells are protected from cytolysis. However, in case of special mutations – e. g. in the case of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) – those protective mechanisms may be partially or completely lost with hemolytic anemia as a consequence. For many years, both C5-directed monoclonal antibodies, eculizumab and ravulizumab, revealed to be very effective agents in PNH management, however, extravascular hemolysis has been remaining a challenge via C3-related opsonization of red blood cell surfaces. As a consequence, novel proximal inhibitors targeting C3 or factor B got more and more important based on the lower incidence of hemolysis. Some of these agents can be administered subcutaneously at home (e. g. pegcetacoplan) or can be applied orally (e. g. iptacopan) which alleviates everyday practice for the patient. Such simplifications will bring the pharmacotherapeutic role of complement inhibitors successively forward also in other rare diseases e. g. in neurology or nephrology.
Key words: avacopan; complement system; C5 inhibitor; danicopan; eculizumab; iptacopan; pegcetacoplan; ravulizumab; sutimlimab; zilucoplan
Welchen Einfluss hat die Darreichungsform bei niedrig dosierter Acetylsalicylsäure?
Bei Patienten, die neben Acetylsalicylsäure (ASS) 100 mg auch Ibuprofen oder Metamizol regelmäßig einnehmen, wird ein Einnahmeabstand von mindestens 30 Minuten empfohlen, um eine Beeinträchtigung der thrombozytenaggregationshemmenden Wirkung zu vermeiden [1]. Dabei muss ASS als schnellfreisetzende Darreichungsform verabreicht werden, die maximale ASS-Plasmaspiegel nach 10 bis 20 Minuten gewährleistet [5]. Bei magensaftresistenten Arzneiformen wird Cmax dagegen erst nach 5 bis 6 Stunden erreicht [11], und die Interaktion wird somit nicht vermieden.
Ist der Einsatz der schnell freisetzenden ASS-Formulierung bedenkenlos möglich oder hat magensaftresistent überzogene ASS 100 mg Vorteile? Wird die gastrointestinale Toxizität hierdurch verringert?
Arzneimitteltherapie 2025;43:67–9.
Akuter Myokardinfarkt
Kein Nutzen für Colchicin nach akutem Myokardinfarkt: die CLEAR-Studie
Mit einem Kommentar des Autors
Bei Patienten, die einen Myokardinfarkt erlitten hatten, führte eine Behandlung mit Colchicin, wenn sie zeitnah nach dem Myokardinfarkt begonnen und im Median drei Jahre lang fortgesetzt wurde, im Vergleich zu Placebo zu keiner geringeren Rate für den kombinierten primären Endpunkt aus Tod durch kardiovaskuläre Ursachen, rezidivierendem Myokardinfarkt, Schlaganfall oder ungeplanter ischämisch bedingter Koronarrevaskularisation.
Myokardinfarkt
Kein bewiesener Nutzen einer routinemäßigen Gabe von Spironolacton nach akutem Infarkt
Die Gabe von Antagonisten des Mineralocorticoid-Rezeptors wie Spironolacton konnte in verschiedenen Studien die Mortalität bei Patienten nach Myokardinfarkt mit kongestiver Herzinsuffizienz reduzieren. Vor allem Patienten mit ST-Strecken-Elevationsinfarkt (STEMI) scheinen von der Behandlung zu profitieren. Eine multinationale Studie sollte nun klären, ob eine routinemäßige Gabe von Spironolacton nach akutem Myokardinfarkt das Überleben oder die Ausprägung der Herzinsuffizienz positiv beeinflusst. Bei den in die Studie eingeschlossenen Probanden mit STEMI und nicht-STEMI war dies nicht der Fall.
Vorhofflimmern
Abelacimab versus Rivaroxaban bei Patienten mit Vorhofflimmern
Mit einem Kommentar des Autors
Bei Patienten mit Vorhofflimmern, die ein mittleres bis hohes Schlaganfallrisiko aufwiesen, führte die Behandlung mit Abelacimab, einem monoklonalen Antikörper gegen Faktor XI, zu deutlich niedrigeren Spiegeln des freien Faktors XI und weniger schwerwiegenden Blutungsereignissen als die Behandlung mit Rivaroxaban.
Gewichtszunahme und mehr Aktivität
Ponsegromab wirksam gegen Tumorkachexie
Dank einer Therapie mit dem GDF-15-Inhibitor Ponsegromab nehmen Tumorpatienten mit Kachexie offenbar mehr an Gewicht zu als unter Placebo. In einer Phase-II-Studie verbesserte sich zudem die Aktivität und Kachexie-Symptome wurden verringert. Die Ergebnisse stützen GDF-15 als Treiber einer Kachexie.
Schweres eosinophiles Asthma
Depemokimab zweimal jährlich reduziert Exazerbationen
Interleukin-5-Antikörper können bei schwerem Asthma die Anzahl der Exazerbationen reduzieren. Depemokimab zeichnet sich durch eine ultralange Wirksamkeit aus. In der vorliegenden Studie werden Wirksamkeit und Sicherheit bei zweimal jährlicher Applikation untersucht.
Dermatomyositis
Wirksamkeit, Sicherheit und Zielwirkung von Dazukibart
Mit einem Kommentar des Autors
In einer randomisierten, Placebo-kontrollierten Phase-II-Studie mit 75 Patienten mit Dermatomyositis führte der Interferon-beta-spezifische monoklonale Antikörper Dazukibart zu einer ausgeprägten Verringerung der Krankheitsaktivität und war gut verträglich. Eine Interferon-beta-Hemmung ist somit eine vielversprechende therapeutische Strategie bei Erwachsenen mit Dermatomyositis.
Colitis ulcerosa
Phase-II-Studie belegt Sicherheit und Wirksamkeit von Tamuzimod
Tamuzimod wurde zur Behandlung der mittelschweren bis schweren aktiven Colitis ulcerosa entwickelt. In einer Phase-II-Studie zeigte der Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptor-Modulator ein günstiges Nutzen-Risiko-Profil. Die Ergebnisse wurden in „The Lancet Gastroenterology & Hepatology“ vorgestellt.
Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
Vedolizumab bringt auch Kinder in Remission
Der Integrin-Antikörper Vedolizumab ist derzeit bei Erwachsenen zur Behandlung von akuten mittelschweren bis schweren Formen des Morbus Crohn, der Colitis ulcerosa sowie einer Pouchitis zugelassen, wenn andere Therapien unzureichend wirkten oder nicht vertragen wurden. In der Studie VEDOKIDS erwies sich Vedolizumab auch bei Kindern mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen als wirksam und sicher.
Vorhofflimmern (VHF) und akuter ischämischer Schlaganfall
Zeitpunkt der Einleitung einer Sekundärprävention mit oralen Antikoagulanzien bei Patienten mit VHF…
Mit einem Kommentar des Autors
Die Ergebnisse einer Metaanalyse zeigen, dass die frühzeitige Einleitung einer oralen Antikoagulation bei Patienten mit akutem ischämischem Schlaganfall und nichtvalvulärem Vorhofflimmern eine bessere Wirksamkeit und ein ähnliches Sicherheitsprofil im Vergleich zu einer späteren Initiierung der Antikoagulation hat.
Hämatologische Tumoren
Sekundäre Malignome nach CAR-T-Zellen nicht häufiger als nach anderen Standardtherapien
Es gibt Bedenken, dass die Therapie mit CAR-T-Zellen vermehrt zu sekundären Malignomen führt. Die Ergebnisse einer neuen Metaanalyse deuten allerdings nicht darauf hin, dass sie nach dieser Behandlung häufiger auftreten als nach anderen Standardtherapien.
Rezidiviertes oder refraktäres follikuläres Lymphom
Hinzufügen von Tafasitamab zum bisherigen Standard wirkt lebensverlängernd
Bei Patienten mit follikulärem Lymphom, die auf eine frühere Therapie nicht angesprochen oder ein Rezidiv erlitten hatten, wurde im Vergleich zu Placebo ein um 57 % verringertes Risiko für ein Fortschreiten der Krankheit, Rückfall oder Tod erzielt, wenn sie – zusätzlich zu zwei Standardarzneimitteln – mit Tafasitamab behandelt wurden. Dies geht aus den ersten Ergebnissen der inMind-Studie hervor, die während der Jahrestagung der amerikanischen Hämatologen (ASH) 2024 vorgestellt wurden.
CMV-Prophylaxe nach Nierentransplantation
Eignet sich Letermovir besonders gut bei hoher Vulnerabilität?
Seit Januar 2024 erstreckt sich die Zulassung des Cytomegalie-Virus(CMV)-DNA-Terminasekomplex-Inhibitors Letermovir auch auf die CMV-Prophylaxe nach Nierentransplantation. Das Arzneimittel scheint weniger hämatotoxisch zu sein als Valganciclovir und sich bei Älteren sowie bei Menschen mit eingeschränkter Nierenfunktion besonders zu eignen.
Seltene Muskelerkrankungen
Neue und etablierte Therapiemöglichkeiten für Patienten mit SMA, ALS oder Friedreich-Ataxie
Ob spinale Muskelatrophie (SMA), amyotrophe Lateralsklerose (ALS) oder Friedreich-Ataxie: Patienten mit seltenen Muskelerkrankungen haben oft einen langen Weg hinter sich, ehe sie ihre Diagnose erhalten. Umso wichtiger sind gute Therapien. Im Rahmen eines von der Firma Biogen veranstalteten Symposiums im Rahmen des DGN-Kongresses 2024 wurden Studienergebnisse zu neuen und etablierten Optionen vorgestellt. Bei einigen Patienten ist nicht nur ein Stillstand der Progression, sondern sogar eine Verbesserung der Erkrankung zu sehen.
Hämophilie A
Paradigmenwechsel in der Therapie mit Efanesoctocog alfa
Die EMA-Zulassung von Efanescotocog alfa zur Behandlung und Prophylaxe von Blutungen bei Hämophilie A führt zu einem Paradigmenwechsel der Therapie. Mit der Erweiterung des Armamentariums um das neue Faktor-VIII-Präparat kann die Kontrolle der Erkrankung und die Lebensqualität der Betroffenen im Vergleich mit den etablierten Therapien deutlich verbessert werden.
Entzündliche Erkrankungen
Ustekinumab-Biosimilar von Celltrion verfügbar
Biosimilars verfügen über eine ähnliche Wirksamkeit und Sicherheit wie Biologika, sind aber meist kostengünstiger. Durch die Preissenkung erhoffen sich Experten eine breitere Anwendung der oft zurückhaltend rezeptierten monoklonalen Antikörper und damit eine bessere Patientenversorgung, wie im Rahmen einer Pressekonferenz von Celltrion diskutiert wurde.
Migräneprophylaxe
Atogepant ab sofort verfügbar
Seit Anfang März 2025 ist Atogepant zur Migräneprophylaxe bei Erwachsenen mit mindestens vier Migränetagen pro Monat in Deutschland auf dem Markt. Wie Patienten von dem ersten oralen Gepant profitieren können, erläuterte Priv.-Doz. Dr. med. Charly Gaul, Frankfurt/M. auf der von AbbVie veranstalteten Launchpressekonferenz.
HR+/HER2– metastasiertes Mammakarzinom
AKT-Inhibitor für die Zweitlinie zugelassen
Für das Estrogenrezeptor-positive, HER2-negative Mammakarzinom gibt es seit 2024 eine neue Zulassung: Capivasertib ist indiziert in Kombination mit Fulvestrant zur Therapie von lokal fortgeschrittenen oder metastasierten Tumoren mit einer oder mehreren PIK3CA/AKT1/PTEN-Alterationen nach Rezidiv oder Progression während oder nach einer endokrinen Therapie.
Chronische Graft-versus-Host-Erkrankung (cGvHD)
Neue Therapieoptionen zielen auf den Pathomechanismus
Für Empfänger allogener hämatopoetischer Stammzelltransplantationen, die eine cGvHD entwickeln, stehen verschiedene Erst- und Zeitlinientherapien zur Verfügung. Viele Patienten brauchen Drittlinienarzneimittel, die zwar bisher in der Europäischen Union noch nicht zugelassen sind, für die es aber vielversprechende Daten gibt.